Woran man starken Haarausfall erkennt
Im Rahmen des natürlichen Haarzyklus ist ein Verlust von bis zu etwa 100 Haaren täglich normal. Wird dieses Maß deutlich überschritten, spricht man von Haarausfall.
Sichtbare Hinweise darauf sind auffällig viele Haare auf dem Kopfkissen oder der Kleidung sowie in Kamm, Bürste oder Ausguss nach dem Haarewaschen. Die Haare erscheinen möglicherweise zunehmend schütter oder dünn und ohne Volumen. An der Kopfhaut können sich lichte oder kahle Stellen zeigen - bei Männern zunächst am häufigsten in Form von „Geheimratsecken" und/oder eines Zurückweichens der Haarlinie an der Stirn, bei Frauen eher durch eine verbreiterte Haarlinie im Bereich des Mittelscheitels.
Oft schreiben uns auch Betroffene, dass Sie auf einmal büschelweise Haarausfall haben. Die Situation wird auch als plötzlicher Haarausfall, starker Haarausfall oder extremer Haarausfall beschrieben.

Die häufigsten Ursachen
Grundsätzlich wird das Haarwachstum von Hormonen gesteuert und erfordert eine gesunde Kopfhaut. Nur so können sich die Haarfollikel für einen kräftigen Haarwuchs gesund entwickeln oder im Idealfall sogar wieder neu bilden.
Für starken Haarausfall kann es viele Gründe geben. Zu den häufigsten Ursachen von Haarausfall zählen:
Sie haben plötzlich stark auftretenden Haarausfall? Häufig geht dem Haarausfall ein sogenanntes telogenes Effluvium voraus: Ein Haar tritt natürlicherweise nach zwei bis sechs Jahren in die Ruhe- oder Ausfallphase (Telogenphase) ein, worauf es sich über einige Monate zunehmend lockert und dann ausfällt.
Bei angegriffenen oder unterversorgten Haarwurzeln beginnt diese Phase jedoch früher, sodass der Haarverlust sichtbar zunimmt. Dieser Zustand ist, wenn die Ursache zeitnah beseitigt wird, zunächst noch reversibel.
Vom plötzlich auftretenden starken Haarausfall ist der sogenannte erblich bedingte Haarausfall (Alopecia androgenetica) abzugrenzen. Der Haarausfall erstreckt sich über mehrere Jahre, begleitet von eher moderatem Haarverlust, der sich im Verlauf wie folgt zeigt:
Ursache ist hierbei eine vererbte Veranlagung, bei der die Haarwurzeln empfindlich auf das Hormon (Dihydro-) Testosteron reagieren.
Wählen Sie die Beschreibung aus, die am ehesten Ihrer Situation entspricht.
Erblich bedingter Haarausfall bei Männern
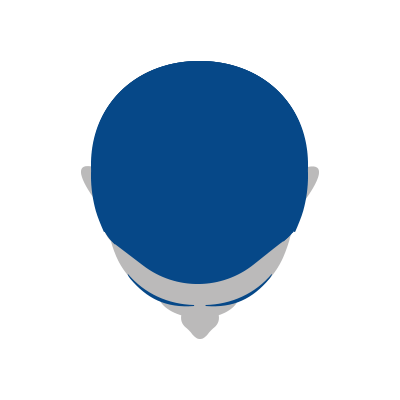
Erblich bedingter Haarausfall bei Frauen

Kreisrunder Haarausfall
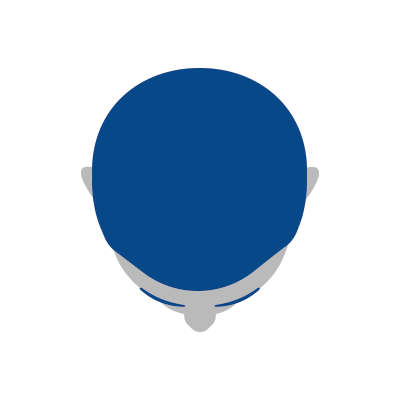
Haarausfall infolge von Chemotherapie
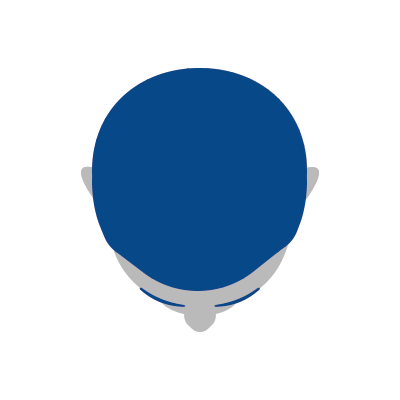
Bei erblich bedingtem (androgenetischem) Haarausfall kommen verschiedene Arzneimittel zur Anwendung, die in der Regel die Wirkung oder Produktion von (Dihydro-)Testosteron reduzieren.
Hintergrund: Haarwurzeln reagieren bei erblich bedingtem Haarausfall häufig überempfindlich auf diesen Testosteronabkömmling und verkümmern dann unter dessen Einfluss. Daher kann eine Reduzierung des Hormons den Haarausfall verlangsamen und das Wachstum neuer Haare fördern.
Bei Frauen mit androgenetischem Haarausfall kommen auch verschreibungspflichtige Antiandrogene zum Einsatz, welche die (Dihydro-)Testosteronrezeptoren blockieren.
Allerdings sollte die innerliche Anwendung gegen die möglichen Nebenwirkungen abgewogen werden.

Äußerlich angewandte Wirkstoffe haben den Vorteil, dass sie direkt am Ort des Geschehens aufgetragen werden und somit auch in der Regel keine systemischen (den ganzen Körper betreffenden) Nebenwirkungen hervorrufen. Das sind meist Wirkstoffe, die regenerierende oder durchblutungsfördernde Eigenschaften vorweisen.
Häufig wird z.B. Koffein eingesetzt. Koffein unterstützt das Wachstum der Haarwurzel in Form von Shampoos oder Tinkturen. Um die Durchblutung der Kopfhaut anzuregen und die Haarfollikel zu aktivieren, werden diese Pflegemittel in die Kopfhaut einmassiert.

Eine weitere Behandlungsoption stellen Thymuspeptide dar: aufgrund zahlreicher unabhängiger Studien und Anwendungsbeobachtungen empfehlen immer mehr Ärzte deren nebenwirkungsfreie Anwendung.
Forschungen haben gezeigt, dass Thymuspeptide, äußerlich angewandt, regenerierend und stärkend auf die Haarfollikel einwirken. Die Zellversorgung an der Haarwurzel wird verbessert, die Bildung neuer Haarzellen unterstützt und die Wachstumsphase der Haare deutlich verlängert.
Thymuspeptide sind organische Verbindungen, die der Körper auch selbst produziert. Sie werden von den Haarfollikeln aufgenommen und kräftigen diese. Das ist ein natürlicher biologischer Vorgang, der bei den meisten Menschen in jungen Jahren von selbst abläuft.
Erst wenn das hormonelle Gleichgewicht kippt, sei es aus Gründen des Alters oder durch äußere Einflüsse wie Stress, kann der Körper die Haarfollikel nicht mehr in ausreichendem Maße selbstständig versorgen.
Dann kann man mit dem Thymuspeptidhaltigen Präparat bei allen Typen von Haarausfall nachhelfen. Thymuspeptide stellen so eine wirksame und nebenwirkungsfreie Alternative dar.
Mehr zu Thymuspeptide und HaarausfallEine ausgewogene Ernährung bei maßvollem Genussmittelkonsum liefert die Nährstoffe für einen gesunden Hautstoffwechsel. Eine tägliche, schonende Bürstenmassage (weiche Borsten) der Kopfhaut soll die Durchblutung der Haarwurzeln zusätzlich stimulieren.
Aufwendig, aber zunehmend verbreitet bei verstärktem Haarausfall: Neben dem Haarersatz wird immer häufiger die – allerdings rein symptomatische – chirurgische Haartransplantation vorgenommen, meist mit einer Verpflanzung von Eigenhaarfollikeln in vielen kleinen Einheiten aus stärker behaarten Kopfregionen.

Haarausfall? Schreiben Sie uns!
Thymuskin bietet Ihnen einen realistische Einschätzung Ihrer persönlichen Situation - auch vor dem Kauf.
» Gefreut hat mich auch die intensive persönliche Beratung, die ich hier erfahren durfte. Das hat mir geholfen, die zwischenzeitlich immer wieder einmal auftretenden entmutigenden Phasen abzuarbeiten. Vielen Dank! «
Gabriele T., Thymuskin Kundin

Hier finden Sie die richtigen Produkte für Ihre persönliche Situation.
Haarausfall am gesamten Kopf
Hierbei handelt es sich um einen verstärkten Haarausfall im Bereich des gesamten behaarten Kopfes.
Kommt es zu Haarausfall, muss man etwas tun. Aber was? Können Shampoos bei Haarausfall eine echte Hilfe sein?